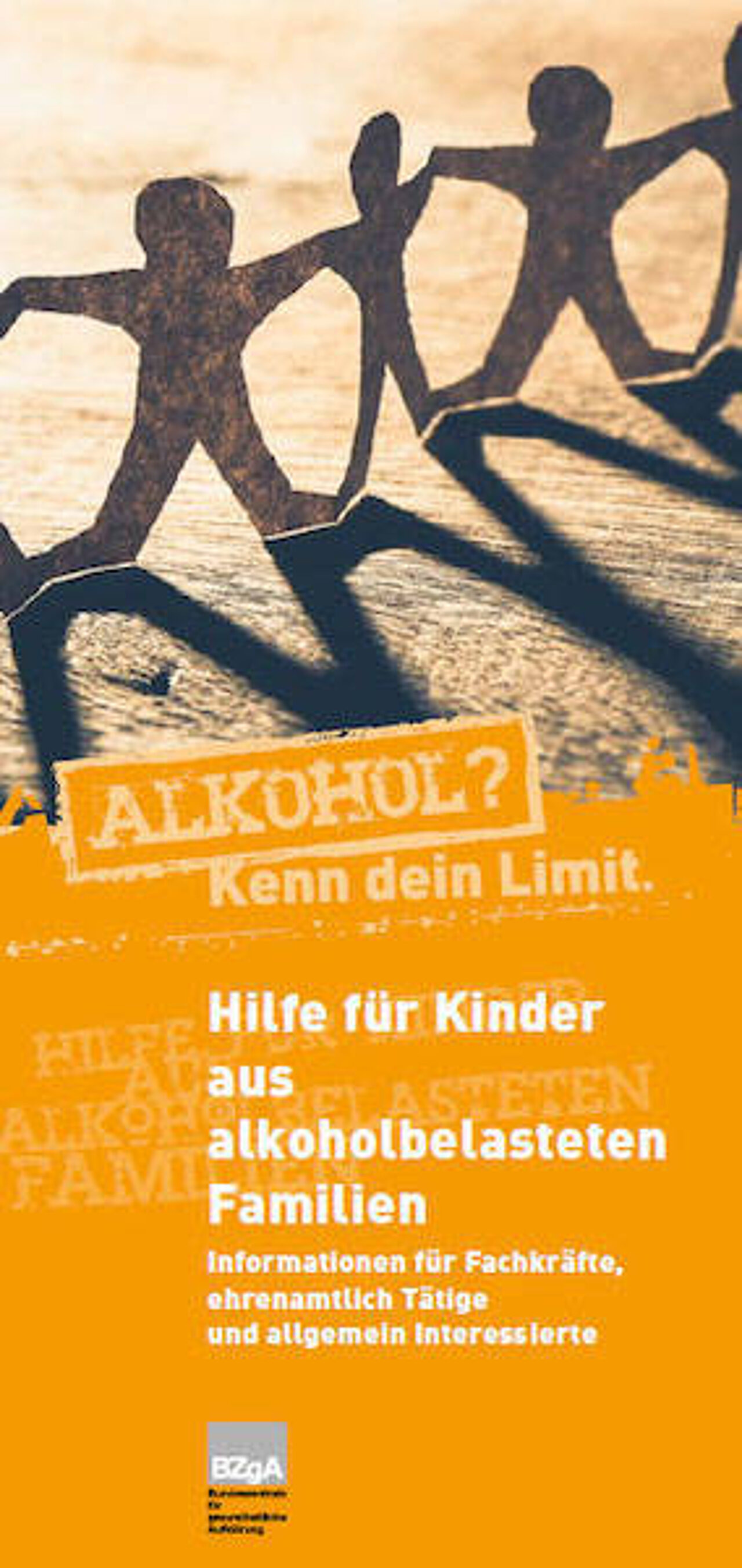Kinder aus alkoholbelasteten Familien
So können Sie betroffenen Kindern und Jugendlichen helfen

In Deutschland wachsen nach Schätzungen etwa eine Million Kinder und Jugendliche mit einem alkoholabhängigen Elternteil auf. Für die betroffenen Kinder und Jugendlichen bedeutet das eine große Belastung. Sie leben in einer emotional unsicheren familiären Situation, die durch geringe Verlässlichkeit und Konflikte bis hin zu körperlicher Gewalt geprägt ist. Sie leiden unter Scham- und Schuldgefühlen und haben selten den Mut, sich anderen anzuvertrauen, oft aus Loyalität zu ihren Eltern.
Zudem haben Kinder alkoholkranker Eltern oft mit Spätfolgen zu kämpfen: Etwa zwei Drittel der betroffenen Kinder entwickeln selbst im Laufe ihres Lebens psychische Störungen oder werden alkoholabhängig. Ihr Risiko, später selbst einmal abhängig zu werden oder eine psychische Krankheit zu entwickeln, ist 2,4 bis 6 mal höher als bei gleichaltrigen Kindern aus nicht suchtbelasteten Familien. Sie beginnen in der Regel früher damit, Alkohol zu trinken und betrinken sich auch eher. Bei einigen betroffenen Kindern ist aber auch ein Umkehreffekt zu sehen: Ganz bewusst verzichten sie aufgrund ihrer negativen Erfahrungen im Elternhaus auf Alkohol.
Was sind die Ursachen für das hohe Suchtrisiko?
Für die Entwicklung einer Suchterkrankung wirken individuumsbezogene und umweltbedingte Faktoren zusammen. Neben möglichen genetischen und psychischen Dispositionen können negative Kindheitserfahrungen, Gewalterlebnisse, Vernachlässigung, die Nachahmung des elterlichen Trinkverhaltens und andere sozioökonomische Einflüsse dazu führen, dass betroffene Kinder einen missbräuchlichen oder abhängigen Alkoholkonsum entwickeln. Wahrscheinlich ist auch, dass Kinder aus suchtbelasteten Familien ein höheres Risiko haben, den gesundheitsschädlichen Umgang mit Alkohol von ihren Eltern zu erlernen.
Wie erkennt man, ob ein Kind betroffen ist?
Es ist nicht leicht zu erkennen, ob ein Kind alkoholkranke Eltern hat. Eindeutige Kriterien gibt es dafür nicht. Anzeichen können sein:
- auffälliges Sozialverhalten, hyperkinetische Störung (ADHS)
- frühreifes, erwachsenes und altersunangemessenes Verhalten („Parentifizierung“)
- Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Angstzustände, Depressionen
- Vermeiden von sozialen Kontakten (Isolierung)
- Unkonzentriertheit, Abwesenheit
- Intelligenzminderung
- Nachlassen der Leistung in der Schule (Schule schwänzen)
Handeln Sie bei Verdacht auf Alkoholmissbrauch in der Familie
Fachkräfte oder Ehrenamtliche, die im sozialen, erzieherischen oder medizinischen Bereich arbeiten, können eine wichtige Rolle bei der Unterstützung betroffener Kinder und Jugendlicher einnehmen. Wenn Sie beobachten, dass sich das Verhalten eines Kindes oder eines Jugendlichen verändert oder auffällig ist, suchen Sie das Gespräch mit ihm oder ihr oder mit den Eltern.
Ein Gespräch mit dem Kind
Wichtig ist, eine vertrauensvolle Beziehung zu dem Kind oder Jugendlichen aufzubauen. Wenn Sie ins Gespräch kommen, beachten Sie folgende Tipps:
- Vermeiden Sie eine Konfrontation oder ein Verhör, in dem das Kind seine Eltern bloßstellen soll.
- Hören Sie zu und zeigen Sie Interesse.
- Bieten Sie dem Kind an, bei Problemen zu Ihnen zu kommen, ohne dass es negative Konsequenzen befürchten muss.
- Versuchen Sie, dem Kind klar zu machen, dass es keine Schuld am Verhalten seiner Eltern trägt.
Ein Gespräch mit den Eltern
Eltern auf ihre Alkoholprobleme und die Folgen für ihre Kinder anzusprechen, erfordert eine äußerst sensible Vorgehensweise. Nicht selten reagieren sie abwehrend, da sie sich schämen oder ertappt fühlen. Ihr Gesprächsziel sollte sein, die Basis für eine gute Zusammenarbeit zu schaffen, um die Situation des betroffenen Kindes zu verbessern.
- Sprechen Sie über Ihre Beobachtungen und Sorgen sachlich. Bleiben Sie stets sachlich, ruhig und respektvoll.
- Vermeiden Sie Schuldzuweisungen.
- Betonen, dass Ihnen das Wohl des Kindes am Herzen liegt.
- Überlegen Sie gemeinsam mit den Eltern, wie weiter vorzugehen ist.
- Vermeiden Sie es, eine Diagnose zu stellen.
Es kann hilfreich für Sie sein, sich mit Dritten zu besprechen. Holen Sie sich beispielsweise Rat von Ihren Kolleginnen und Kollegen. Auch an Suchtberatungsstellen oder Erziehungsberatungsstellen können Sie sich wenden.
Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Wohl des Kindes gefährdet ist, müssen Sie handeln. Sie können sich dann an Beratungsstellen öffentlicher und gemeinnütziger Träger der Kinder- und Jugendhilfe (z. B. beim Jugendamt, aber auch bei Erziehungs- und Beratungsstellen) wenden, um eine mögliche Kindeswohlgefährdung abzuklären. Sie haben dort Anspruch auf eine Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft (§ 8b SGB VIII).
Broschüren zum Bestellen
Anregungen zur kindgerechten Ansprache sowie Hinweise für das Gespräch mit den Eltern finden Sie in folgenden Broschüren, die in Kooperation von BIÖG und Deutscher Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (DHS) entwickelt wurden.
- "Mia, Matz und Moritz ... und ihre Mama, wenn sie wieder trinkt“ für Kinder im Vorschulalter
- Begleitheft zu "Mia, Matz und Moritz" für Fachkräfte
- "Luis und Alina ... wenn die Eltern trinken" für 10- bis 15-Jährige
- Begleitheft zu "Luis und Alina" für Fachkräfte
- Broschüre für Fachkräfte „Suchtprobleme in der Familie“
- Arbeitshilfe für Fachkräfte „Erwachsenwerden in Familien Suchtkranker“
- Flyer für Jugendliche und junge Erwachsene mit einem suchtkranken Familienmitglied „Ich finde meinen Weg“
- Flyer für Fachkräfte „Hilfe für Kinder aus alkoholbelasteten Familien“
Weiterführende Informationen für Fachkräfte
- w-kis.de
Wissensnetzwerk Kinder in suchtbelasteten Familien für Fachleute und Interessierte - NACOA Deutschland – Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien e.V.
Email- und Telefonberatung für Betroffene und Fachkräfte, moderierter Gruppenchat für Betroffene, Liste von Hilfeangeboten der Kommunen und Länder - Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS)
Arbeitsfeld Kinder aus Suchtfamilien - Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH)
NEST-Material für Fachkräfte zur Unterstützung ihrer Arbeit mit Familien - Fitkids
Evaluiertes Organisationsentwicklungsprogramm für Sucht- und Drogenberatungsstellen, die Kinder aus suchtbelasteten Familien systematisch berücksichtigen wollen - “Kinderschutz und Prävention”
Beitrag in den BIÖG-Leitbegriffen der Gesundheitsförderung und Prävention - COA.KOM
Kommunikationsplattform für Fachkräfte zur Arbeit mit Kindern aus psychisch und suchtbelasteten Familien
Unterstützungsangebote für Familien, Kinder und Jugendliche
- KidKit
Chat- und E-Mailberatung für betroffene Kinder - Nummer gegen Kummer
Telefon 116111 (kostenfrei), Montag bis Samstag 14:00 bis 20:00 Uhr - Krisenchat
24/7 Krisenberatung für junge Menschen über WhatsApp und SMS - Hilfen im Netz
Kinder und Jugendliche mit suchtkranken oder psychisch kranken Eltern erhalten hier Hilfe und Informationen - Frühe Hilfen
Angebote für Eltern von Kindern von 0 bis 3 Jahren in schwierigen Situationen. Mit der Postleitzahlensuche finden Sie Links zu Anlaufstellen der Frühen Hilfen in Ihrer Nähe. - Al-Anon Familiengruppen
Selbsthilfegemeinschaft für Angehörige und Kinder von Alkoholikern - bke-Onlineberatung
Das anonyme, kostenfreie Beratungsangebot für Jugendliche und Eltern der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) - Videoreihe „Geh' deinen Weg – das ist okay!“ der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (DHS)
- NACOA Deutschland – Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien e.V.
Email- und Telefonberatung für Betroffene und Fachkräfte, moderierter Gruppenchat für Betroffene, Liste von Hilfeangeboten der Kommunen und Länder - Trau dir!
Beratung und Informationen von NACOA, der Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien
- Klein, M. (2005). Kinder aus suchtbelasteten Familien. Familie und Sucht. Grundlagen, Therapiepraxis, Prävention, 52-60.
- Klein, M., Thomasius, R., & Moesgen, D. (2017). Kinder suchtkranker Eltern-Grundsatzpapier und Fakten zur Forschungslage. Drogen-und Suchtbericht, 83-95.
- Kraus, L., Uhl, A., Atzendorf, J., & Seitz, N. N. (2021). Estimating the number of children in households with substance use disorders in Germany. Child and adolescent psychiatry and mental health, 15(1), 63.
- Lachner, G., & Wittchen, H. U. (1997). Familiär übertragene Vulnerabilitätsmerkmale für Alkoholmissbrauch und-abhängigkeit. In Abhängigkeit und Missbrauch von Alkohol und Drogen (pp. 43-90). Hogrefe.
- Ulrich, I., Stopsack, M., & Barnow, S. (2010). Risiko-und Resilienzfaktoren von adoleszenten Kindern alkoholkranker Eltern: Ergebnisse der Greifswalder Familienstudie. Diskurs Kindheits-und Jugendforschung/Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research, 5(1), 47-61.